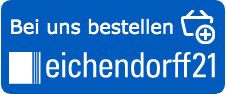Alfred Brendel
Spiegelbild und schwarzer Spuk
Gedichte
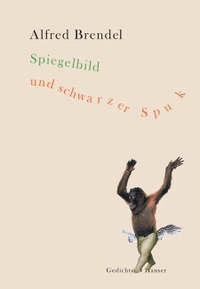
Carl Hanser Verlag, München 2003
ISBN 9783446203495
Gebunden, 287 Seiten, 19,90 EUR
ISBN 9783446203495
Gebunden, 287 Seiten, 19,90 EUR
Klappentext
Mit Abbildungen von Max Neumann, Luis Murschetz, Oskar Pastior und anderen. Der Pianist als Dichter: Mit seinen komischen und grotesken Versen baut Alfred Brendel eine luftige Brücke zwischen Sinn und Unsinn. So wird bei ihm Beethoven (der, was auch ziemlich unbekannt ist, ein Neger war) als Mörder von Mozart entlarvt oder die bewegende Frage erörtert, was geschah, als Brahms sich in den Finger geschnitten hatte. In Brendels Gedichten - von denen sämtliche in diesem Band versammelt sind - kommt alles und jeder zur Sprache, sogar ein Speckschwein, das am Telefon grunzend seine Lebensgeschichte erzählt.
Rezensionsnotiz zu Neue Zürcher Zeitung, 15.01.2004
Von diesem Band mit Gedichten des Pianisten Alfred Brendel aus den vergangenen zehn Jahren scheint Michael Braun ziemlich begeistert zu sein. Er stellt fest, dass Brendel in seinen Arbeiten auf eine in der "Moderne wenig genutzte" lyrische Gattung zurückgreift, nämlich auf den "komödiantischen Vers". Die Gedichte sind von seltsamen Tieren wie dem "Speckschwein", einem Dromedar mit Dackelbeinen oder einem "schnarchenden Hund", aber auch "Klavierteufeln", Engeln und Gespenstern belebt, so der Rezensent amüsiert. Er stellt fest, dass Brendel kein Interesse an "spracheexperimentellen Konstruktionen" hat, sondern unverdrossen dem Wortwitz, dem Kalauer und der Anarchie huldigt, wobei er die "Lesbarkeit" seiner Gedichte "nicht als Skandal empfindet", wie der Rezensent eingenommen betont.
Rezensionsnotiz zu Süddeutsche Zeitung, 15.01.2004
Auf "saturierten und darüber dumm gewordenen Atheismus" kann man sich als Schriftsteller im 21. Jahrhundert nicht mehr zurückziehen, meint Andreas Dorschel apodiktisch, und deshalb ist er nicht zuletzt wegen des klugen und gewitzten Skeptizismus begeistert von diesem Gedichtband des Pianisten Alfred Brendel. Denn Brendels Gedichte bewegen sich nicht in mittlerweile staubigen Erkenntnissen wie dem viel beschworenen Tod Gottes, sondern wagen "entschiedene Unentschiedenheit", so der Rezensent überzeugt. Ihn beeindruckt besonders, wie der Autor in den "religiösen Bildern", die er in seinen Versen aufruft, das Bizarre aufscheinen lässt, das ja "immer schon" darin enthalten war, wie Dorschel fasziniert bemerkt. Er preist Brendels "kaustischen Witz", der ihn an Lichtenberg, Swift und Canetti erinnert, und betont, dass es ein Fehler wäre, diese Gedichte lediglich als eine Art Überdruckventil oder Ausgleichssport eines vielbeschäftigten Virtuosen zu unterschätzen. Die "Verspieltheit" der Gedichte ist alles andere als "harmlos", warnt der Rezensent, dem es besonders imponiert, dass der Autor selbst verehrten Komponisten respektlos begegnen kann. Diese Gedichte sind in Wahrheit "Aphorismen und intellektuelle Vexierbilder" und Brendel ein "Skeptiker", der nicht nur den "bösen Blick" schult, sondern auch in der Lage ist, sich "mit einem lachenden Auge" selbst zu sehen, so Dorschel hingerissen.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.deThemengebiete
Kommentieren