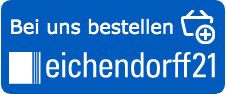Iwan Bunin
Verfluchte Tage
Ein Revolutionstagebuch
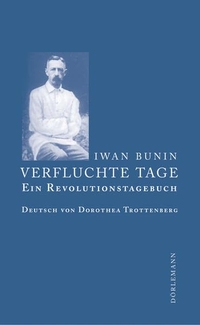
Dörlemann Verlag, Zürich 2005
ISBN 9783908777175
Gebunden, 260 Seiten, 19,80 EUR
ISBN 9783908777175
Gebunden, 260 Seiten, 19,80 EUR
Klappentext
Aus dem Russischen übersetzt sowie mit Anmerkungen versehen von Dorothea Trottenberg und mit einem Nachwort von Thomas Grob. Erstmals auf Deutsch liegt mit "Verfluchte Tage" das Tagebuch Iwan Bunins aus der Zeit des russischen Bürgerkriegs vor. Durch Rückgriffe auf die vorrevolutionäre Zeit und die Tage der Februarrevolution entsteht ein bedeutendes - und in seiner Vehemenz singuläres - Zeitzeugnis, in dem Bunins ablehnende Haltung gegenüber der Revolution unverhüllt zum Ausdruck kommt.
"Verfluchte Tage" ist kein Tagebuch im üblichen Sinne, sondern ein streng durchkomponiertes literarisches Werk. Es fußt auf den Notizen, die Bunin unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse 1918/19 in Moskau und Odessa gemacht hat. Ereignisse, die nicht nur für sein Heimatland, sondern auch für sein persönliches Schicksal entscheidend waren und dazu führten, daß er 1920 Russland für immer verließ. "Okajannye dni" erschien in Buchform erstmals 1935 bei Petropolis in Berlin und gilt als ein Schlüssel zum Verständnis Bunins.
"Verfluchte Tage" ist kein Tagebuch im üblichen Sinne, sondern ein streng durchkomponiertes literarisches Werk. Es fußt auf den Notizen, die Bunin unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse 1918/19 in Moskau und Odessa gemacht hat. Ereignisse, die nicht nur für sein Heimatland, sondern auch für sein persönliches Schicksal entscheidend waren und dazu führten, daß er 1920 Russland für immer verließ. "Okajannye dni" erschien in Buchform erstmals 1935 bei Petropolis in Berlin und gilt als ein Schlüssel zum Verständnis Bunins.
Rezensionsnotiz zu Süddeutsche Zeitung, 02.02.2006
Für Volker Breidecker ist die deutsche Ausgabe des Augenzeugenberichts über die Russische Revolution von Iwan Bunin ein "literarisches Kleinod", das vorzüglich übersetzt und kommentiert wurde. Der aus verarmtem Adel stammende Bunin, der bis zur Revolution einer der am meisten gelesenen Schriftsteller seines Landes war und später der erste russische Nobelpreisträger wurde, veröffentlichte die "Verfluchten Tage" nach seiner Flucht zuerst in einer Pariser Exilzeitschrift. Als "kunstvolle und beinahe lyrische Komposition" durchkreuzen die Aufzeichnungen die offizielle Chronologie der Ereignisse, indem der Autor, auf gloriosen Anfang und Schluss verzichtend, mit dem alten, von den Revolutionären abgeschafften russischen Kalender einsetze. Die in Tagebuchform literarisch aufgearbeiteten Erinnerungen des Exilanten zeugen von einem einsamen, "verzweifelten Akt des Widerstands", dem angesichts trotzkistischer Gräueltaten die Vorstellungskraft versage. Die "ästhetische und politische Sprengkraft" der buninschen Schriften liege in der Form novellistischer Einträge, die Bunin zum "radikalen Miniaturisten" werden lassen, so der angetane Rezensent.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.deRezensionsnotiz zu Neue Zürcher Zeitung, 18.10.2005
Achtzig Jahre hat es gedauert bis Iwan Bunins zunächst als Feuilletons veröffentlichte Revolutions-Tagebücher endlich - und dazu noch "mustergültig" - ins Deutsche übersetzt wurden, schreibt ein dankbarer Ulrich M. Schmid. Mit leisem Amüsement berichtet der Rezensent, dass Bunin nicht nur keinen Hehl daraus mache, dass er die Oktoberrevolution von 1917 als "apokalyptischen Untergang der russischen Kultur" betrachte, sondern diese, aufgrund seiner "aristokratischen Haltung, wie der Rezensent einwirft, weniger als politische denn als ästhetische Katastrophe wahrnehme. Davon zeuge der dokumentierte Ekel sowohl vor den politischen Rednern als auch vor deren Zuhörern. Erwähnenswert findet der Rezensent, dass Bunin auch Maxim Gorki scharf ins Visier nimmt und dessen "prinzipienlosen Opportunismus" anhand von Zitaten belegt. Auf den ersten Blick "unauffällig gegliedert", ahmen die Tagebücher in ihrer Komposition die Struktur der "altrussischen Chroniken" nach und erweisen sich als auf den zweiten Blick als "streng durchkomponiertes Kunstwerk". Bunins Tagebücher liefern, auch dank der unkommentierten Zeitdokumente, die vom Autor immer wieder eingefügt werden, ein hochauthentisches Zeitzeugnis der Oktoberrevolution, so das zufriedene Fazit des Rezensenten.
Themengebiete
Kommentieren